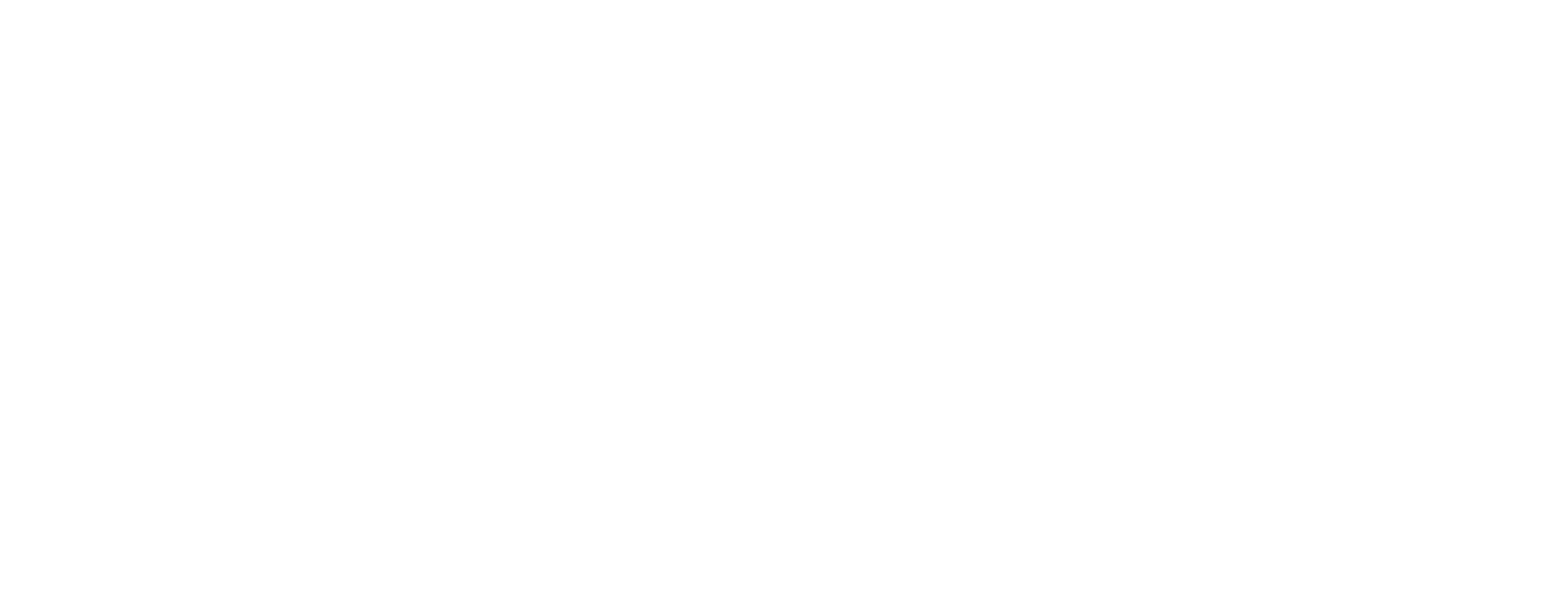Prof. Dr. Peter Loskill ist Professor für Organ-on-Chip-Systeme an der Eberhard Karls Universität in Tübingen und am NMI Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut in Reutlingen. 2016 gründete er das µOrgano-Lab, um neuartige mikrophysiologische Gewebemodelle zu entwickeln, und er ist Leiter des 3R-Centers in Tübingen. Herr Prof. Dr. Loskill möchte mit seiner Arbeit die Zahl der Versuchstiere reduzieren und wird dafür 2024 mit dem Ursula M. Händel-Tierschutzpreis ausgezeichnet. Im Interview mit 3R-Forschung.de spricht er darüber, wie nach Tierversuchsalternativen gesucht wird, welche Alternativmethoden bereits nutzbar sind und erklärt, wie sich die Zahl der Versuchstiere in Deutschland im nächsten Jahrzehnt sogar halbieren ließe.
Wie gehen Sie am 3R-Center für In-vitro-Modelle und Tierversuchsalternativen in Tübingen vor, wenn Sie an Alternativen zu Tierversuchen forschen?
Im interdisziplinären und internationalen µOrganoLab im 3R-Center Tübingens entwickeln wir modernste Organ-on-Chip-Modelle als Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen. Je nach Fragestellung gehen wir meist so vor, dass wir zunächst die Mikrostruktur und funktionellen Einheiten des Organs genau studieren, das wir im Chip nachbilden möchten. Dabei arbeiten Mediziner:innen, Biolog:innen und Pharmazeut:innen eng mit Ingenieur:innen, Medizintechniker:innen und Physiker:innen zusammen.
Nachdem das Studiendesign ausgearbeitet wurde, entwickeln wir eine passende Chipplattform. Das beinhaltet eine Vielzahl komplexer Arbeitsschritte, wie die Auswahl geeigneter Chipmaterialien, die Integration von Sensorelementen (zum Beispiel zur Messung des Sauerstoffgehalts oder des pH-Werts) oder die Anpassung und Optimierung des Systems, bis es den Anforderungen des jeweiligen Organs bzw. dem Anwendungsszenario gerecht wird.
Je nach Organ werden die benötigten gewebespezifischen Zellen entweder aus menschlichem Spendergewebe isoliert oder aus induziert pluripotenten Stammzellen gewonnen, also aus umprogrammierten Zellen mit dem Potenzial, sich in verschiedene Zelltypen zu entwickeln. Im Chip werden die Zellkonstrukte kontinuierlich mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, während Stoffwechselprodukte abtransportiert werden. Also ganz so, wie es auch im menschlichen Körper passiert.
Im Anschluss müssen spezifische Analysemethoden und experimentelle Vorgehensweisen (sogenannte Assays) für das Chipsystem entwickelt werden. Mithilfe eines Werkzeugkastens aus Readouts, unter anderem mit integrierten Sensoren, können dann Daten generiert werden, die es erlauben, Aussagen über den Zustand und die Dynamiken der Gewebe im Chip zu treffen.
Und daraus lassen sich dann Rückschlüsse auf Krankheiten und mögliche Therapien schließen?
Unter anderem, ja. Werden im Zuge des Chipaufbaus krankhaft veränderte Zellen für die Generierung der Gewebe verwendet oder spezifische Krankheitszustände, etwa Infektionen, induziert, können sogenannte Krankheitsmodelle aufgebaut werden. Sie helfen Erkrankungen auf molekularer Ebene zu verstehen und gezielt Medikamente oder Therapieansätze gegen die jeweilige Erkrankung zu entwickeln und zu testen. Auch für die Untersuchung möglicher Giftigkeiten, zum Beispiel im Verbraucherschutz, können diese mikrophysiologischen Systeme herangezogen werden.
In der angewandten Forschung der pharmazeutischen Industrie werden schon vermehrt Alternativmethoden eingesetzt [...]. Dies hat bereits zu einer signifikanten Reduzierung der Anzahl von Tierversuchen geführt.
In der angewandten Forschung der pharmazeutischen Industrie werden schon vermehrt Alternativmethoden eingesetzt, insbesondere im Bereich der Modellierung von Krankheiten und der mechanistischen Toxikologie. Dies hat bereits zu einer signifikanten Reduzierung der Anzahl von Tierversuchen geführt. Weitere erfolgreiche Implementierungen von Alternativmethoden sind in verschiedenen Forschungsbereichen wie zum Beispiel der Entwicklungsbiologie, der personalisierten Medizin und der Infektionsbiologie (beispielsweise in der COVID-19-Forschung) zu verzeichnen.
Es gibt aber auch Forschungsbereiche, in denen in absehbarer Zeit nicht mit einem Ersatz von Tierversuchen gerechnet werden kann. Hierzu zählen zum Beispiel die Erforschung psychologischer Erkrankungen (beziehungsweise in der Verhaltensforschung), initiale Pharmakokinetikstudien, um die optimale Dosierung und Sicherheit von Medikamenten zu verstehen, sowie die Beantwortung wissenschaftlicher Fragestellungen in der Reproduktionstoxikologie, also zu den Auswirkungen von Chemikalien und Substanzen auf die Entwicklung eines ungeborenen Kindes während der Schwangerschaft.
Generell stoßen auch komplexe In-vitro-Modelle häufig noch dann an ihre Grenzen, wenn es um komplexe Wechselwirkungen zwischen mehreren Organen (etwa in der Diabetesforschung) geht. Ähnliches gilt auch für die Untersuchung neurologischer Erkrankungen oder bei der Testung von Implantaten.
Ist die 3R-Forschung Ihrer Ansicht nach unterfinanziert? Wie könnte man die Finanzierung auf andere Füße stellen?
Um die Entwicklung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen erfolgreich voranzutreiben und deren Anwendung nachhaltig in die Forschungslandschaft zu implementieren, bedarf es in Deutschland in der Tat dringend weitreichender Förderinitiativen. Dies gilt für sämtliche relevanten Bereiche, angefangen bei Stammzellen über Organoide und Organ-on-Chip-Modelle bis hin zu In-silico-Modellen. Die Entwicklung dieser Methoden ist im internationalen Vergleich tatsächlich noch sehr unterfinanziert.
Damit die innovativen Modelle dann auch in die breite Anwendung gelangen, ist es darüber hinaus essenziell, Forschenden den Zugang zu innovativen Technologien, aber auch zu den notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnissen zu erleichtern. Das bedeutet, dass die erforderliche Infrastruktur geschaffen werden muss. Dabei geht es sowohl um die adäquate Vorhaltung spezifischer Infrastruktur als auch um die angemessene Ausbildung derjenigen, die Studien konzipieren und durchführen. Wenn all diese Maßnahmen umgesetzt werden, könnte die Anzahl der notwendigen Tierversuche meiner Einschätzung nach im nächsten Jahrzehnt halbiert werden.
Sie haben sich viele Jahre mit der Forschung an Organ-on-Chip-Technologien auseinandergesetzt. Wie weit ist diese Forschung inzwischen? Können Sie Tierversuche irgendwann komplett ersetzen oder werden sie stets eine Ergänzung bleiben?
Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass In-vitro-Modelle keinesfalls ausschließlich als reiner Ersatz zu bestehenden Tierversuchen betrachtet werden sollten. Es geht nicht darum, einen spezifischen Tierversuch eins zu eins durch eine Alternativmethode zu ersetzen. Stattdessen stehen die Entwicklung und Bereitstellung neuartiger, alternativer Modelle im Fokus. Sie ermöglichen es, Studien basierend auf menschlichen Zellen und Geweben durchzuführen und diese ergänzend miteinander zu kombinieren. Modelle wie Organ-on-Chip- und generelle Mikrophysiologische Systeme bieten ein enormes Potenzial, wissenschaftliche Fragestellungen in solch einem für den Menschen relevanten Kontext, zu beantworten, wie sie durch Tiermodelle nicht beantwortet werden könnten.
Aus all diesen alternativen Daten können dann Informationen zusammengetragen werden, deren Ergebnisse einzelne Tierversuche reduzieren beziehungsweise im besten Fall gänzlich ersetzen können. Möglicherweise können sie sogar Fragestellungen beantworten, die mit Tiermodellen bisher überhaupt nicht beantwortbar sind. Dazu zählen im Speziellen Fragestellungen der personalisierten Medizin und der geschlechtersensiblen Forschung. Unterschiede zwischen individuellen Patient:innen wie zum Beispiel geschlechtsspezifische Unterschiede können durch Verwendung von Geweben aus Stammzellen oder Biopsatmaterial in vitro nachgebildet werden.
Lebenslauf Prof. Dr. Peter Loskill:
- 1984 Geboren
- Physik-Studium an der Universität des Saarlandes
- 2013 bis 2015 Postdoktorand an der University of California
- 2016 Rückkehr nach Deutschland. Fortsetzung seiner Forschungen am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik
- 2016 Gründung des µOrgano-Lab
- 2016 Auszeichnung als "Innovator unter 35" vom MIT Technology Review Germany
- 2018 Berufung zum Juniorprofessor an der Medizinischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen
- 2021 Wechsel vom Fraunhofer-Institut an das NMI Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut
- 2021 Berufung zum Universitätsprofessor und Übernahme der Leitung des 3R-Centers Tübingen
- 2024 Ausgezeichnet mit dem Ursula M. Händel-Tierschutzpreis zusammen mit Dr. Silke Riegger vom 3R-Center Tübingen
Inwiefern müsste die Gesetzeslage an die Forschung nach Alternativmethoden angepasst werden?
Viele Gesetze stammen noch aus einer Zeit, in der es keine wirklichen Alternativen zu Tierversuchen gab. Das hat sich inzwischen glücklicherweise geändert. Daher werden auch sukzessive Gesetze angepasst und modernisiert, wie beispielsweise kürzlich durch den FDA Modernisation Act in den USA. Allerdings, auch wenn es hier noch eine Menge Anpassungsbedarf gibt, sind es nicht unbedingt die Gesetze oder regulatorischen Vorgaben, die die Anwendung von Alternativmethoden ausbremsen. Hier spielen Faktoren wie Förderprogramme, fehlende Infrastrukturen und Training als auch Gewohnheiten eine relevante Rolle.
Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz bei der Suche nach Alternativen zum Tierversuch?
Künstliche Intelligenz und In-silico-Modelle im Allgemeinen können einen großen Beitrag für den Ersatz von Tierversuchen spielen. Es ist bereits heute möglich, mithilfe von künstlicher Intelligenz komplexe biologische Prozesse sowie Sicherheit und Wirkmechanismen von neuen, potenziellen Wirkstoffen vorherzusagen. Speziell in Kombination mit komplexen Gewebemodellen bietet die künstliche Intelligenz ein immenses Potenzial, neue Hypothesen zu generieren, Muster in den großen generierten Datenmengen zu erkennen und Zusammenhänge in einer Komplexität auszutesten, die kein Modell allein erreichen könnte. Nur durch diese Kombination kann in ferner Zukunft über einen kompletten Ersatz von Tierversuchen nachgedacht werden.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die EU-Kommission weiter an den 3R-Grundsätzen und den umgesetzten Verboten im Rahmen der EU-Kosmetikverordnung festhält.
Welche Bedeutung hat die Antwort der EU-Kommission auf die Europäische Bürgerinitiative "Save cruelty-free cosmetics" im vergangenen Sommer für die 3R-Forschung?
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die EU-Kommission weiter an den 3R-Grundsätzen und den umgesetzten Verboten im Rahmen der EU-Kosmetikverordnung festhält. Die große Frage für die 3R-Forschung ist allerdings, inwiefern diese Bestrebungen dann auch substanziell vorangetrieben werden. Es ist nicht nur wichtig, über Verbote zu diskutieren und unverbindliche Unterstützungsbekundungen auszusprechen, sondern auch konkrete Maßnahmen und Instrumente einzuführen. Bei diesen Punkten gibt es leider noch erheblichen Handlungsbedarf.