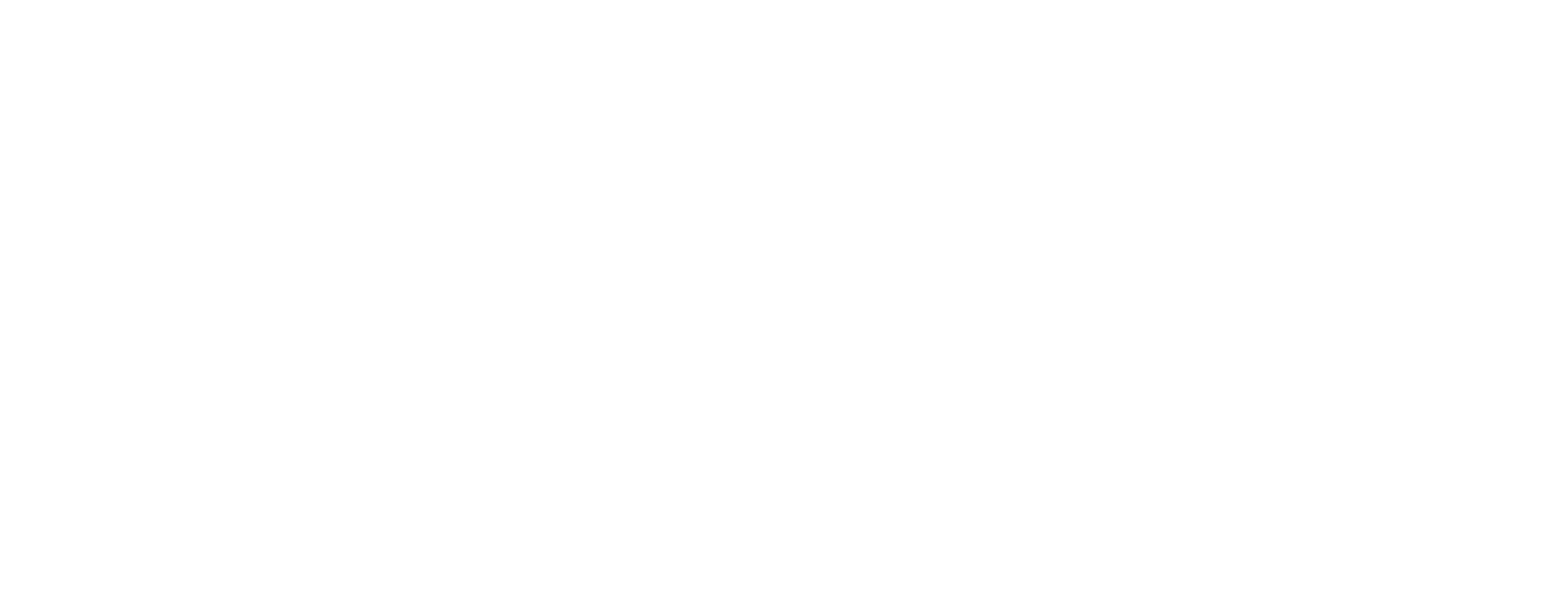Das 3R-Prinzip bildet die Basis für den Schutz von Tieren, die zu wissenschaftlichen Zwecken in Versuchen eingesetzt werden. Die drei R stehen für die Begriffe Replace (Vermeiden), Reduce (Verringern) und Refine (Verfeinern). Sie fördern das gesamtgesellschaftliche Ziel, den Einsatz von Versuchstieren auf ein Minimum zu reduzieren. Konkret bedeutet das, Forschende müssen sich vor jedem Tierversuchsantrag die Fragen stellen: Gibt es Möglichkeiten, den geplanten Tierversuch durch den Einsatz anderer Methoden zu vermeiden (Replace)? Wird die Anzahl der eingesetzten Versuchstiere auf das unerlässliche Maß reduziert (Reduce)? Werden die Belastungen und Verfahren, denen die Tiere ausgesetzt sind, durch andere Versuchsabläufe verbessert (Refine)?
Das 3R-Prinzip geht zurück auf die beiden britischen Wissenschaftler William Russell und Rex Burch, die die 3R erstmals 1959 in ihrem Buch „The Principles of Humane Experimentel Technique“ definierten. Damals beobachteten Russell und Burch ein exponentielles Wachstum der medizinischen und veterinärmedizinischen Forschung sowie der pharmazeutischen Industrie, das wiederum einen enormen Anstieg der Versuchstierzahlen zur Folge hatte. Offiziell wurde die Zahl noch nicht erhoben, die beiden Forscher gingen aber schon damals von mehreren Millionen Versuchstieren pro Jahr aus.
Ursprünge im 19. Jahrhundert
Russel und Burch waren aber nicht die ersten, die sich Gedanken um den Schutz von Versuchstieren machten. Die beiden beziehen sich in ihrem Buch unter anderem auf den sogenannten „Cruelty to Animal Act“ aus dem Jahr 1876. Diese Vorschrift des Vereinigten Königreichs gilt gemeinhin als das erste Gesetz zur Verwendung und Behandlung von lebenden Tieren in der Forschung. Welche Rolle spielt die Anästhesie bei der Beurteilung von Schmerzen? Sind Versuche unter Narkose immer noch grausam? Welche Arten von Tieren benötigen oder verdienen Schutz? Die Ansätze des „Cruelty to Animal Act“ bildeten erstmals den komplexen Konflikt zwischen wissenschaftlichem Fortschritt durch Tierversuche auf der einen und dem Wohlbefinden von Lebewesen auf der anderen Seite ab. Aus der Auseinandersetzung mit diesem Thema entstanden später die 3R.
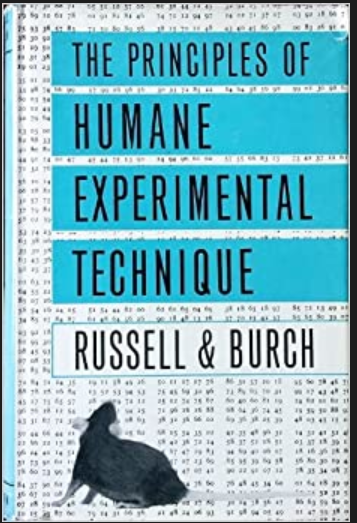
Seitdem sind die 3R in der Wissenschaft als allgemeingültiges Prinzip zum Schutz von Versuchstieren verankert. Aber erst durch die „Basler Deklaration zur tierexperimentellen Forschung“ im Jahr 2010 erfuhren sie zum ersten Mal gesetzliche Anerkennung.

Foto: Europäisches Parlament
Über 60 Wissenschaftler*innen aus der Schweiz, Deutschland, England, Frankreich und Schweden verabschiedeten am 30. November 2010 die Deklaration, in der sie sich zu mehr Verantwortung bei Tierversuchen und zu einer intensiven Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit verpflichteten. Die Unterzeichnenden wollten aber auch zeigen, dass Wissenschaft und Tierschutz keine Gegensätze sein müssen. Die Deklaration führte schließlich zu einer Verpflichtung aller EU-Staaten, das 3R-Prinzip ab spätestens Januar 2013 in ihr nationales Recht zu übernehmen.
3R-Forschung heute
Die 3R bilden heute die Leitplanken für den wissenschaftlichen Umgang mit Versuchstieren. Wie kann das Prinzip aber in der Praxis bestmöglich umgesetzt werden? Und welche Methoden helfen dabei, Tierversuche nachhaltig zu verringern, zu vermeiden und zu verfeinern? Einen großen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen liefern die europäischen 3R-Zentren wie das National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3R) in London, das 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences (ULS) in Utrecht oder das Swiss 3Rs Competence Center (3RCC) in Bern. In Deutschland gehören dazu zum Beispiel das deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren (Bf3R) oder das 3R-Zentrum der Berliner Charité „Charité 3R Berlin“.
Unabhängig davon wird aber auch an zahlreichen weiteren Institutionen zur Realisierung der 3R geforscht – so auch bei den Initiierenden dieses Portals: Forschende von „R2N“ beschäftigen sich mit den beiden Grundsätzen Reduce und vornehmlich Replace. Die DFG-Forschungsgruppe „Severity Assessment“ arbeitet daran, die Belastung von Tieren im Tierversuch einzuschätzen, zu bewerten und darauf aufbauend zu verringern. Sie befasst sich also mit dem Aspekt „Refine“.
Grundsätze bis heute unumstritten
Das 3R-Prinzip ist in der Wissenschaft flächendeckend anerkannt, seine Gültigkeit bleibt unumstritten. Und dennoch arbeiten Forschende daran, die 3R zu verbessern oder zu erweitern – zum Beispiel durch die Aufnahme weiterer „R“ für bestimmte Aspekte des Tierschutzes.
So berücksichtigen die Forschenden der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) in ihrer Grundsatzerklärung von 2016 ein zusätzliches "R" für „Responsibility“ (Verantwortung). Zur Erfüllung des vierten R verpflichtet sich die MPG unter anderem dazu, das Sozialleben von Versuchstieren zu verbessern, die wissenschaftliche Grundlage für eine objektive Ermittlung von Empfindungsfähigkeit, Schmerzerfahrung, Bewusstsein und Intelligenz in der Tierwelt weiterzuentwickeln und die Professionalisierung des öffentlichen Diskurses über Fragen der Tierethik aktiv zu unterstützen.
CAMARADES Berlin, eine Einrichtung am Berlin Institute of Health Quest Centre for Responsible Research, überprüft Studien mit Tieren systematisch und liefert Meta-Analysen der Tierversuche. Dadurch wollen die Forschenden mögliche Fehlerquellen im Studiendesign aufdecken, um so in der Berichterstattung von Tierversuchen unnötige Forschung von geringem wissenschaftlichem Wert zu vermeiden und somit die Reproduzierbarkeit der Versuche zu verbessern.
Der Tierschutz-Aspekt des 3R-Prinzips reicht indes alleine reicht nicht aus, glaubt ein Forschungsteam der Berliner Charité um Prof. Daniel Strech und Prof. Ulrich Dirnagl. Bei der Frage nach der ethischen Vertretbarkeit von Tierversuchen kommt demnach dem wissenschaftlichen Wert der Forschung eine besondere Bedeutung zu. Ihr Ansatz sieht daher drei weitere R („Robustheit“, „Registrierung“ und „Reporting“) vor: Tierversuche müssen belastbar sein („Robustness“). Es muss eine Registrierung der Versuche erfolgen, ähnlich wie bei Studien an Menschen („Registration“). Und schließlich müssen die Ergebnisse der Studien aussagekräftig veröffentlicht werden. („Reporting“).

© Charité | Wiebke Peitz
Der „6R-Roundtable“, eine Initiative von Berliner Wissenschaftler*innen möchte das 3R-Prinzip ebenfalls um drei weitere R ausbauen. Die Initiative bezieht den Gedanken des „Culture of Care“ (Kultur der Fürsorge) mit ein. Das 3R-Prinzip wird somit neben dem R für „Responsibility“ um die beiden Aspekte „Respect“ (Respekt) und „Reproducibility“ (Reproduzierbarkeit) erweitert.
Viele Meilensteine in der biomedizinischen Forschung wären ohne Tierversuche nicht möglich gewesen. Das stellten bereits William Russell und Rex Burch in ihrem Buch „The Principles of Humane Experimentel Technique“ fest. Und auch heute kann die Wissenschaft noch nicht komplett auf Tierversuche verzichten – zu diesem Schluss kommt auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in einem kürzlich veröffentlichten Thesenpapier. Dass sich wissenschaftlicher Fortschritt und Tierschutz dennoch nicht ausschließen müssen, stellten Russel und Burch, die Begründer des 3R-Prinzips, schon 1959 fest. Dieser Grundsatz hat bis heute Bestand.